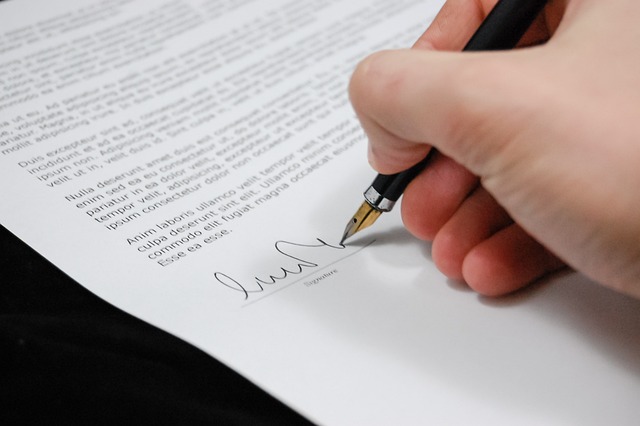Die sofortige Beschwerde der Mutter gegen den Beschluss des Amtsgerichts – Familiengericht – Duderstadt vom 14.02.2025 wird zurückgewiesen.
Die Mutter hat die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren zu tragen; die außergerichtlichen Kosten der Beteiligten werden nicht erstattet.
In der Familiensache
betreffend die elterliche Sorge für
L. N., geb. TT.MM.2019,
weitere Beteiligte:
1. J.-C. N.,
– Mutter, Antragstellerin und Beschwerdeführerin –
Verfahrensbevollmächtigter:
Rechtsanwalt A. B.
Geschäftszeichen: ,
2. L. N.,
– Vater, Antragsgegner und Beschwerdegegner –
hat das Oberlandesgericht Braunschweig – 1. Senat für Familiensachen – durch die Richterin am Oberlandesgericht Dr. E. als Einzelrichterin am 18.03.2025 beschlossen:
Tenor:
Gründe
I.
Die Mutter begehrt die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das erstinstanzliche Verfahren, mit dem sie die Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge für ihre derzeit sechsjährige Tochter L. anstrebt.
Die gemeinsam sorgeberechtigten Kindeseltern sind seit November 2020 rechtskräftig geschieden. Seit deren Trennung im August 2019 lebt L. im Haushalt der Mutter. Auf anwaltliche Aufforderung vom TT.07.2024 unterzeichnete der Vater am TT.07.2024 eine Sorgerechtsvollmacht, mit der er die Mutter bevollmächtigte, in allen Angelegenheiten der elterlichen Sorge für die Tochter L. für ihn zu handeln. Die Vollmacht umfasst ausdrücklich insbesondere die Regelungsbereiche Behördenangelegenheiten inklusive Antragstellungen in sozialrechtlichen und familienrechtlichen Bereichen, Regelung von Kindergartenangelegenheiten und schulischen Angelegenheiten, Vermögensangelegenheiten jeglicher Art, medizinische Angelegenheiten/Gesundheitsangelegenheiten jeglicher Art sowie das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Seine Unterschrift unter der Vollmachtsurkunde ließ der Vater notariell beglaubigen (UV-Nr. ./. des Notars K.).
In der Antragsschrift vom 18.12.2024 macht die Mutter geltend, zwischen ihr und dem Vater bestehe keine Kommunikationsbasis. Ein gemeinsames Gespräch im Jugendamt habe zuletzt im September 2024 stattgefunden, nachdem bei L. durch den Kinderarzt ADHS diagnostiziert worden sei. Auf ihre anschließenden Emails zur Information und Absprache hinsichtlich der weiteren medizinischen Vorgehensweise habe der Vater nicht reagiert. Ein im November 2024 zwischen den Eltern geführtes Telefongespräch sei eskaliert. Der Vater habe dabei u. a. mitgeteilt, keine Umgänge mehr mit L. wahrnehmen zu wollen. Die anstehenden medizinischen Entscheidungen und Behandlungen sowie die im Jahr 2025 bevorstehende Einschulung würden eine gemeinsame Elternarbeit erfordern, die zwischen ihr und dem Vater jedoch nicht möglich sei. Daher entspreche die Übertragung der elterlichen Sorge auf sie allein dem Wohl des Kindes am besten.
Mit weiteren Schriftsätzen vom 14.01.2025 und 10.02.2025 hat die Mutter ergänzend vorgetragen, sie sei in Anbetracht des zerrütteten Verhältnisses zum Kindesvater, der am Leben des Kindes nicht mehr teilhabe, nicht länger bereit, nur mit einer auf sie lautenden Sorgerechtsvollmacht zu operieren. Angesichts der vollständig fehlenden Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern und des Umstandes, dass Sorgerechtsvollmachten durch Ärzte, Behörden und Banken häufig trotz Unterschriftsbeglaubigung nicht akzeptiert würden, gebe die Vollmacht vorliegend keine ausreichend verlässliche Handhabe zur Wahrnehmung der Kindesbelange.
Das Amtsgericht hat den Antrag der Mutter auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe mit Beschluss vom 14.02.2025, auf den wegen der Einzelheiten seiner Begründung Bezug genommen wird, zurückgewiesen, da die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg biete. Die Sorgerechtsvollmacht vom TT.07.2024 stelle eine verlässliche Handhabe zur Wahrnehmung von L.s Angelegenheiten dar. Eine Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft des Vaters sei nur erforderlich, soweit eine solche auch angesichts der Vollmacht notwendig sei. Inwiefern dies vorliegend der Fall sei, habe die Mutter nicht dargelegt. Dem Gericht sei auch nicht bekannt, dass Ärzte und Banken Sorgerechtsvollmachten generell nicht akzeptierten.
Gegen den ihrem Verfahrensbevollmächtigten am 18.02.2025 zugestellten Beschluss wendet sich die Mutter mit der am 26.02.2025 beim Amtsgericht eingegangenen sofortigen Beschwerde. Zu deren Begründung wiederholt sie ihre Rechtsauffassung, nach der bei absoluter Kommunikationslosigkeit die Erteilung einer Sorgerechtsvollmacht nicht das mildere Mittel zu einem Sorgerechtsentzug darstelle, zumal im Falle einer Verbesserung der Elternkooperation jederzeit ein Antrag auf Rückübertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge gestellt werden könne.
Mit Beschluss vom 28.02.2025 hat das Amtsgericht der Beschwerde nicht abgeholfen und die Angelegenheit dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.
II.
Die gemäß § 76 Abs. 2 FamFG i.V.m. §§ 567 ff. ZPO zulässige sofortige Beschwerde ist unbegründet. Die Entscheidung des Amtsgerichts, den Antrag der Mutter auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg der beabsichtigten Rechtsverfolgung gemäß § 76 Abs. 1 FamFG i.V.m. § 114 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen, hat auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens Bestand.
Hinreichende Erfolgsaussicht ist gegeben, wenn der von dem Verfahrenskostenhilfe begehrenden Beteiligten dargelegte Rechtsstandpunkt auf Grund seiner Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen vertretbar erscheint und die Möglichkeit der Beweisführung besteht (Zöller/Schultzky, ZPO, 35. Auflage 2024, § 114 Rn. 22 m.w.N.). Unter dem grundrechtlichen Aspekt der Rechtsschutzgleichheit für Bemittelte und Unbemittelte sind insoweit keine überspannten Anforderungen zu stellen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.10.2019 – 2 BvR 1813/18, juris Rn. 25). Es ist weder eine Erfolgsgewissheit noch eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für den Erfolg zu verlangen. Vielmehr reicht eine gewisse, nicht nur entfernte Erfolgsaussicht (vgl. Zöller/Schultzky, a.a.O., Rn. 23). Um Verfahrenskostenhilfe zu verweigern, muss ein Erfolg in der Hauptsache demnach zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die Erfolgschance darf aber nur eine entfernte sein (BVerfG, a.a.O., Rn. 27). Letzteres ist vorliegend der Fall. Auf der Grundlage der Darlegungen der Mutter besteht lediglich eine sehr entfernte Chance für einen Erfolg ihres Antrags auf Übertragung der Alleinsorge für die gemeinsame Tochter L.
Die Erfolgsaussicht ist nach Maßgabe von § 1671 Abs. 1 Nr. 2 BGB zu beurteilen. Danach ist dem Antrag eines Elternteils auf Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge stattzugeben, wenn zu erwarten ist, dass sowohl die Aufhebung der gemeinsamen Sorge als auch die Übertragung derselben auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Die erste dieser beiden Voraussetzungen ist erfüllt, wenn die Ausübung der gemeinsamen Sorge nicht in kindeswohldienlicher Weise möglich ist.
1. Dies ist in der Regel der Fall, wenn es an einer tragfähigen sozialen Beziehung zwischen den Eltern fehlt und zwischen ihnen auch kein Mindestmaß an Übereinstimmung sowie keine hinreichende Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation vorhanden sind. Denn dann besteht die Gefahr, dass die Eltern ihren Konflikt auf dem Rücken des Kindes austragen, womit dieses in seiner Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt und in seiner Entwicklung gefährdet werden kann (vgl. BVerfG, Urteil vom 29.01.2003 – 1 BvL 20/99, juris Rn. 61 m.w.N.; BGH, Beschluss vom 12.12.2007 – XII ZB 158/05, juris Rn. 11 ff.; Beschluss vom 15.06.2016 – XII ZB 419/15, juris Rn. 23 ff.). Sofern zwischen den Eltern ein konstruktiver Austausch über Belange des Kindes unmöglich ist, besteht zudem die Gefahr, dass notwendige Entscheidungen nicht oder jedenfalls nicht zeitnah getroffen werden können. Bei einer derartigen Sachlage entspricht in der Regel die Aufhebung der gemeinsamen elterlichen Sorge dem Kindeswohl am besten. Nach der Darlegung der Mutter ist dies vorliegend der Fall, da der Vater seit einiger Zeit kein Interesse mehr an der gemeinsamen Tochter zeige und jegliche Kommunikation und Kooperation hinsichtlich ihrer Belange verweigere.
2. Der Annahme einer Kindeswohlwidrigkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge und damit der Erfolgsaussicht des beabsichtigten Antrags der Mutter steht hier jedoch die ihr vom Vater erteilte umfassende Sorgerechtsvollmacht entgegen, die trotz der mangelnden elterlichen Kommunikation und Kooperation eine Handlungsfähigkeit in den Belangen des Kindes ermöglicht.
a) Eine Übertragung der Alleinsorge hat nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu unterbleiben, wenn die Handlungsbefugnisse des betreuenden Elternteils bereits durch eine vom anderen Elternteil erteilte Sorgerechtsvollmacht erweitert sind und er dadurch in die Lage versetzt wird, in den maßgeblichen Kindesbelangen allein tätig zu werden (vgl. BGH, Beschluss vom 29.04.2020 – XII ZB 112/19, juris Rn. 29; OLG Brandenburg, Beschluss vom 29.03.2022 – 10 U 43/21, juris Rn. 27). Gibt eine erteilte Sorgerechtsvollmacht unter den gegebenen Umständen dem bevollmächtigten Elternteil eine ausreichend verlässliche Handhabe zur Wahrnehmung der Kindesbelange, so ist ein Eingriff in das Sorgerecht nicht erforderlich. Wie vom Amtsgericht zutreffend dargestellt, setzt dies eine ausreichende Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft der Eltern voraus – allerdings nur, soweit eine solche auch unter Berücksichtigung des durch die Vollmacht erweiterten Handlungsspielraums des bevollmächtigten Elternteils unerlässlich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 29.04.2020 – XII ZB 112/19, juris Rn. 21 und 28; OLG Frankfurt, Beschluss vom 22.12.2020 – 8 UF 61/18, juris Rn. 31; OLG Köln, Beschluss vom 22.07.2022 – II-14 UF 66/22, juris Rn. 28).
Dabei kann eine Vollmacht weder allgemein als in der Regel ungeeignet angesehen werden noch bleibt deren Eignung zur verlässlichen Wahrnehmung der Kindesbelange auf Fälle beschränkt, in denen zwischen dem Kind und dem vollmachtgebenden Elternteil ein persönlicher Kontakt besteht. Vielmehr ist im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden, ob die Vollmacht unter den gegebenen Umständen ausreicht, um die Kindesbelange verlässlich wahrnehmen zu können (BGH, a.a.O., Rn. 34). Entscheidend ist dabei letztlich die Prognose, ob und inwieweit durch die erteilte Vollmacht künftig Streit zwischen den Eltern vermieden werden kann oder aber ob der für das Kindeswohl nachteilige Elternstreit trotzdem fortgesetzt werden wird (vgl. OLG Frankfurt, a.a.O., Rn. 32). Insoweit kommt es darauf an, ob in Situationen, in denen trotz Vollmacht die Mitwirkung beider Eltern an anstehenden sorgerechtlichen Entscheidungen erforderlich ist, eine Kooperation von ihnen erwartet werden kann (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 40 ff.; OLG Köln, a.a.O., Rn. 30 ff.; OLG Frankfurt, a.a.O., Rn. 31 und Rn. 34 ff.). Dies erfordert die einzelfallbezogene Feststellung konkret erforderlicher, aber praktisch ausgebliebener oder aufgrund sonstiger Anhaltspunkte künftig nicht zu erwartender Mitwirkungshandlungen (vgl. OLG Bremen, Beschluss vom 07.09.2023 – 5 UF 13/23, juris Rn. 27; OLG Frankfurt, a.a.O., Rn. 32 und Rn. 34; Prinz, NZFam 2022, 983). Soweit in der Rechtsprechung teilweise allein auf das Fehlen einer elterlichen Kommunikationsbasis und die darauf beruhende abstrakte Gefahr ausbleibender Mitwirkungshandlungen abgestellt wird (so OLG Dresden, Beschluss vom 25.03.2022 – 21 UF 427/21, juris Rn. 12), überzeugt dies nicht. Denn in den von der Vollmacht umfassten Bereichen bedarf es in der Regel keiner elterlichen Kooperation und keiner gemeinsamen Entscheidungen der Eltern mehr (OLG Brandenburg, Beschluss vom 29.03.2022 – 10 U 43/21, juris Rn. 26 f.).
Die Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Auflösung des gemeinsamen Sorgerechts trotz Vollmachterteilung trifft dabei den die Alleinsorge beantragenden Elternteil (OLG Frankfurt, a.a.O., Rn. 32 m.w.N.; OLG Bremen, a.a.O.).
b) Nach diesen Grundsätzen ergeben sich vorliegend aus dem Vorbringen der Mutter keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die vom Vater erteilte umfassende Sorgerechtsvollmacht ihr keine verlässliche Handhabe für die Wahrnehmung von L.s Belangen bietet.
aa) Der Umstand, dass der Vater keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hat, spielt nach der oben genannten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keine Rolle, da die Eignung der Vollmacht zur Wahrnehmung der Kindesbelange nicht von Kontakten zwischen dem vollmachtgebenden Elternteil und dem Kind abhängt.
bb) Aufgrund des Inhalts der Vollmacht, die sich auf alle wesentlichen sorgerechtlichen Bereiche erstreckt, ist ohne Vortrag entsprechender Anhaltspunkte nicht zu erwarten, dass in bestimmten Angelegenheiten trotz der Sorgerechtsvollmacht noch eine Mitwirkung des Vaters erforderlich werden wird.
cc) Soweit die Mutter generell darauf verweist, Sorgerechtsvollmachten würden häufig durch Ärzte, Banken und Behörden nicht anerkannt, genügt auch dies nicht, um im vorliegenden Einzelfall von einer Ungeeignetheit der Vollmacht ausgehen zu können. Daran ändern auch die bei L. gestellte ADHS-Diagnose und die dadurch notwendig werdenden Entscheidungen über medizinische Behandlungen nichts. Denn die Mutter hat nicht vorgetragen, dass die ihr erteilte Vollmacht in einer bestimmten Situation durch einen der behandelnden Ärzte ihrer Tochter nicht akzeptiert wurde und dass dadurch eine Mitwirkung des Vaters an einer anstehenden Entscheidung erforderlich wurde. Die notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Vaters erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit einer Akzeptanz der Vollmacht im Rechtsverkehr, da damit etwaige Zweifel daran, dass die Unterschrift vom sorgeberechtigten Vater stammt, ausgeräumt werden. Ohne die konkrete Darlegung von Situationen, in denen sich die am TT.07.2024 erteilte Sorgerechtsvollmacht im Rahmen der Regelung sorgerechtlicher Angelegenheiten als nicht ausreichend erwiesen hat, kann jedoch nicht von deren fehlender Eignung zur verlässlichen Wahrnehmung von L.s Belangen ausgegangen werden.
dd) Auch für den Fall, dass sich die erteilte Sorgerechtsvollmacht künftig in einer bestimmten Angelegenheit wider Erwarten nicht als ausreichend erweisen sollte, bieten die Schilderungen der Mutter keine hinreichende Grundlage für die Annahme, dass der Vater dann einer konkreten Aufforderung zur Mitwirkung nicht nachkommen würde. Immerhin hat er im Juli 2024 auf anwaltliche Aufforderung zeitnah die von der Mutter verlangte Sorgerechtsvollmacht erteilt. Ferner ist er noch im September 2024 der Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch im Jugendamt gefolgt. Soweit er im Zeitraum danach auf Emails der Mutter sowie auf eine weitere Gesprächseinladung ins Jugendamt nicht mehr reagiert hat, ist nicht vorgetragen, dass es dabei um erforderliche Mitwirkungshandlungen im Rahmen der gemeinsamen Sorgerechtsausübung ging.
ee) Auch die Möglichkeit eines Widerrufs der erteilten Vollmacht schließt es nicht aus, dass diese eine Sorgerechtsübertragung entbehrlich machen kann. Denn ein Widerruf kommt nur zum Tragen, wenn er tatsächlich erklärt worden ist, wohingegen allein die Möglichkeit eines Widerrufs der Eignung einer Vollmacht zur Wahrnehmung der Kindesbelange nicht entgegensteht (BGH, a.a.O., Rn. 39; OLG Köln, a.a.O.; OLG Brandenburg, a.a.O., Rn. 22; OLG Bremen, a.a.O., Rn. 29). Vorliegend fehlt es zudem an Anhaltspunkten dafür, dass der Vater einen Widerruf der Vollmacht beabsichtigt oder jemals in Aussicht gestellt hat.
Insgesamt ist die Chance, dass sich bei Durchführung des Verfahrens, Einholung einer Stellungnahme des Jugendamts und ggf. weiteren Ermittlungen wird feststellen lassen, dass die Vollmacht vorliegend keine ausreichend verlässliche Handhabe zur Wahrnehmung der Belange der gemeinsamen Tochter darstellt, aufgrund des bisherigen Vorbringens der Mutter allenfalls als entfernt zu beurteilen.
III.
Die Mutter hat nach §§ 1, 3 Abs. 2 FamGKG i.V.m. Nr. 1912 der Anlage 1 zum FamGKG die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren zu tragen. Außergerichtliche Kosten sind gemäß § 76 FamFG i.V.m. § 127 Abs. 4 ZPO nicht zu erstatten.
OLG Braunschweig, Beschluss vom 18.03.2025
1 WF 32/25